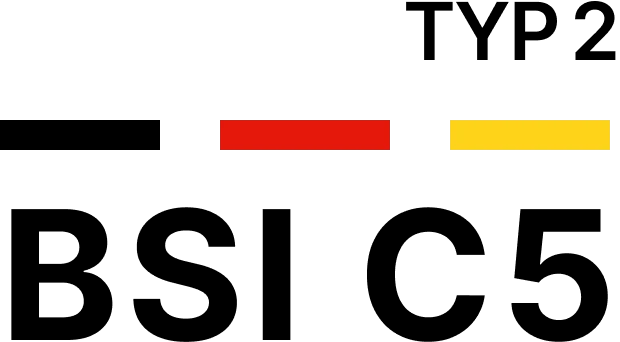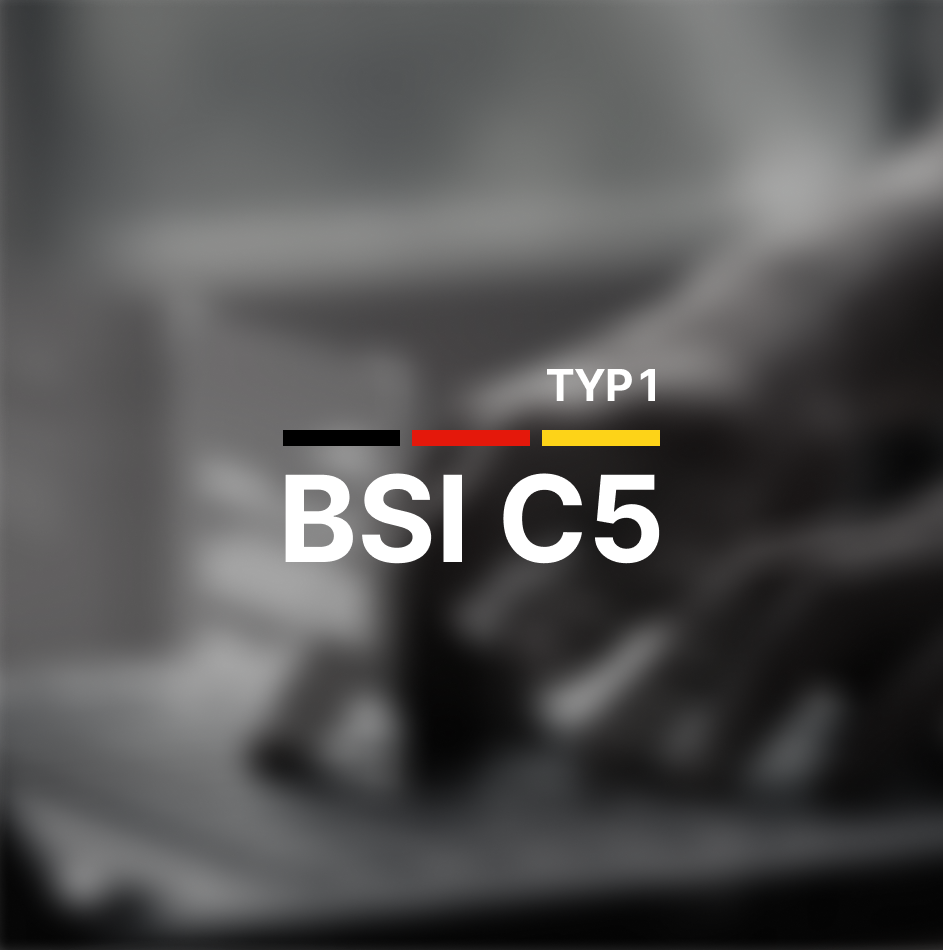Zwischen TikTok und Therapie-App – Wie Jugendliche digitale Unterstützung bei psychischen Belastungen nutzen und was Europa daraus macht

Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen steht seit Jahren verstärkt im Fokus von Forschung, Politik und Versorgungspraxis. Spätestens seit der Corona-Pandemie ist klar: Immer mehr junge Menschen leiden unter psychischen Belastungen – von Ängsten und Depressionen bis hin zu Essstörungen und Suchtverhalten. Gleichzeitig verbringen Jugendliche heute einen großen Teil ihrer Freizeit in digitalen Welten: auf TikTok, Instagram, YouTube oder in Messengern wie WhatsApp.
Es liegt daher nahe, dass digitale Medien nicht nur Teil des Problems, sondern auch Teil der Lösung sein können. Digitale psychologische Unterstützungsangebote (DPUs) versprechen einen niedrigschwelligen Zugang zu Informationen, Austausch und sogar therapeutischen Interventionen. Doch wie werden diese Angebote tatsächlich genutzt? Und wie gehen europäische Gesellschaften mit Chancen und Risiken sozialer Medien um?
Zwei aktuelle Impulse geben Antworten: Eine Studie der Uniklinik RWTH Aachen untersuchte die reale Nutzung von DPUs durch Jugendliche in psychiatrischer Behandlung. Auf europäischer Ebene wiederum diskutierte das Network for Psychotherapeutic Care in Europe (NPCE) gemeinsam mit der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), welche politischen, schulischen und therapeutischen Strategien notwendig sind, um Kinder und Jugendliche im digitalen Zeitalter zu schützen und zu stärken.
1. Digitale Unterstützung: Was Jugendliche wirklich nutzen – Ergebnisse der RWTH Aachen
Unter dem Titel „Mehr Likes als Wirkung? Nutzung digitaler psychologischer Unterstützungsangebote bei Jugendlichen mit psychischen Störungen“ stellte ein Forschungsteam der Uniklinik RWTH Aachen auf dem DGDM Symposium 2025 der Deutschen Gesellschaft für digitale Medizin ein Poster vor, das sich genau dieser Frage widmet (Kohl et al., 2025).
Was sind digitale psychologische Unterstützungsangebote (DPUs)?
DPUs umfassen ein breites Spektrum digitaler Formate, die im Kontext psychischer Gesundheit genutzt werden können:
- Unregulierte Angebote: Social Media, Online-Communities, Blogs, Chatbots
- Informationsplattformen: Webseiten zu psychischen Störungen, Podcasts, Videos
- Strukturierte Interventionen: Online-Programme, Apps
- Regulierte Gesundheitsanwendungen: z. B. in Deutschland zugelassene Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs)
Vor allem unregulierte Angebote sind für Jugendliche leicht zugänglich – die Hürden, ein TikTok-Video zu öffnen, sind deutlich geringer als die Nutzung einer zertifizierten Therapie-App.
Studiendesign
Befragt wurden Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren aus der (teil-)stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie der RWTH Aachen. Die Datenerhebung erfolgte anonym über eine Online-Plattform. Neben der Nutzung von DPUs wurden auch demografische Daten, Angaben zu psychischen Beschwerden, digitale Gesundheitskompetenz und allgemeines Medienverhalten erfasst.
Erste Ergebnisse
Die Zwischenergebnisse zeichnen ein deutliches Bild:
- Social Media dominiert: TikTok, Instagram und YouTube sind die am häufigsten genutzten Formate.
- ChatGPT als Problemlöser: Viele Jugendliche greifen auf KI-basierte Systeme zurück, um mit psychischen Belastungen umzugehen.
- Evidenzbasierte Angebote bleiben Randerscheinung: Qualitativ geprüfte, wissenschaftlich fundierte digitale Interventionen finden kaum Anwendung.
- Negative Erfahrungen: Viele Jugendliche berichten von problematischen Erlebnissen – etwa durch verstörende Inhalte, Cybermobbing oder den Einfluss von Influencer:innen, die falsche Gesundheitsinformationen verbreiten.
Diskussion der Ergebnisse
Die Forschenden betonen die zentrale Lücke: Während ein hoher Bedarf an Unterstützung besteht, werden evidenzbasierte DPUs kaum genutzt. Stattdessen dominieren kommerzielle Plattformen, deren Inhalte häufig nicht reguliert sind und die Risiken bergen können.
Damit liefert die Aachener Untersuchung wichtige empirische Grundlagen, um zu verstehen, warum Jugendliche zwar digital nach Unterstützung suchen, dabei aber oft auf ungeeignete Kanäle zurückgreifen. Diese Ergebnisse sind ein Weckruf für Politik, Gesundheitswesen und Bildung: Es reicht nicht, digitale Hilfsangebote verfügbar zu machen – sie müssen so gestaltet werden, dass Jugendliche sie auch tatsächlich nutzen.
2. Von der Klinik zur Gesellschaft: Europäische Perspektiven auf Social Media und psychische Gesundheit
Die Ergebnisse aus Aachen werfen die Frage auf, wie Gesellschaften, Bildungssysteme und Politik mit der Kluft zwischen Bedarf und tatsächlicher Nutzung umgehen. Genau hier setzt die Diskussion auf europäischer Ebene an.
Beim Treffen des Network for Psychotherapeutic Care in Europe (NPCE) 2025, das von der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) mitorganisiert wurde, stand die Frage im Zentrum: „Wie beeinflussen soziale Medien die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen?“ (BPtK-Newsletter 03/2025).
Regulierung und politische Initiativen
- Auf europäischer Ebene wird intensiv über Schutzmaßnahmen diskutiert: Altersgrenzen für Social-Media-Nutzung, verpflichtende Altersverifikationen, Handyverbote an Schulen, Vorgaben für nicht suchterzeugendes Plattform-Design.
- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, Expert:innen einzuberufen, die klären sollen, wie die Nutzung sozialer Medien für Minderjährige sinnvoll begrenzt werden kann.
- Auch der Ministerrat betont die Notwendigkeit von Prävention, digitaler Gesundheitskompetenz und strikter Regulierung.
Chancen und Risiken sozialer Medien
Die Diskussion machte deutlich: Soziale Medien sind weder per se gefährlich noch ausschließlich nützlich.
- Chancen: Jugendliche erleben Zugehörigkeit, Akzeptanz und Vernetzung, die in ihrem analogen Umfeld oft fehlen. Soziale Medien können sichere Räume bieten und sogar Gesundheitsbildung unterstützen.
- Risiken: Gleichzeitig begünstigen unrealistische Körperbilder, Cybermobbing, Gewalt- und Pornografie-Inhalte sowie die „Fear of Missing Out“ (FOMO) psychische Erkrankungen. Besonders gefährdet sind Jugendliche mit bestehenden psychischen Problemen, niedrigem Selbstwertgefühl oder fehlender familiärer Unterstützung.
Praxisbeispiele aus Europa
Die Tagung stellte auch konkrete Initiativen aus verschiedenen Ländern vor:
Österreich:
- Seit 2022 fördert das Gesundheitsministerium ein Programm, das Jugendlichen schnellen Zugang zu Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen ermöglicht.
- Angeboten werden Psychoedukation sowie bis zu 15 Therapieeinheiten.
- Hohe Nachfrage hat dazu geführt, dass das Programm verlängert und finanziell ausgebaut wurde – mit dem Ziel, es in die Regelversorgung zu überführen.
Finnland:
- Digitale Gesundheitskompetenz ist fester Bestandteil des Lehrplans. Programme wie „Feeling Good“ und „Youth Compass“ vermitteln Resilienz und psychische Strategien von der Grundschule bis zur Hochschule.
- Innovative Ansätze wie Online-Spiele sollen psychologische Flexibilität fördern.
- Forschung zeigt: Jugendliche profitieren besonders dann, wenn digitale Angebote alltagsnah, spielerisch und kontinuierlich genutzt werden.
- Wichtig ist die enge Einbindung von Fachkräften – digitale Tools sollen klassische Therapien ergänzen, nicht ersetzen.
3. Gemeinsame Linien – was wir lernen können
Die beiden Quellen – die Studie aus Aachen und die europäischen Diskussionen – ergänzen sich in aufschlussreicher Weise:
- Realität der Jugendlichen: Jugendliche suchen digitale Unterstützung, landen aber häufig bei nicht evidenzbasierten Inhalten.
- Politische und gesellschaftliche Antwort: Europa arbeitet daran, Schutzmechanismen einzuführen und gleichzeitig die Chancen digitaler Medien nutzbar zu machen.
- Best-Practice-Beispiele: Österreich und Finnland zeigen, dass es möglich ist, niedrigschwellige, qualitätsgesicherte Angebote bereitzustellen und sie in Alltagsstrukturen wie Schule und Versorgung einzubetten.
- Zentrale Herausforderung: Angebote müssen nicht nur existieren, sondern auch attraktiv, niedrigschwellig und an die Lebenswelt Jugendlicher angepasst sein.
Fazit: Likes allein reichen nicht – aber sie können der Einstieg sein
Die psychische Gesundheit junger Menschen wird auch in den kommenden Jahren ein zentrales gesellschaftliches Thema bleiben. Die Forschung der RWTH Aachen verdeutlicht, dass Jugendliche digitale Unterstützung aktiv suchen – oft jedoch an den falschen Stellen. Social Media bieten zwar Gemeinschaft und Austausch, bergen aber erhebliche Risiken, wenn sie nicht reguliert und begleitet werden.
Europa diskutiert daher zurecht über Schutzmaßnahmen, Prävention und digitale Gesundheitskompetenz. Gleichzeitig zeigen Länder wie Österreich und Finnland, dass evidenzbasierte, attraktive und niedrigschwellige Angebote sehr wohl angenommen werden – wenn sie in den Alltag integriert sind und echte Unterstützung bieten.
Die Aufgabe für die kommenden Jahre lautet: Jugendliche dort abholen, wo sie sind – auf TikTok, Instagram oder YouTube – und ihnen gleichzeitig Wege eröffnen, die über Likes und kurze Clips hinaus zu nachhaltiger Unterstützung führen. Nur so können digitale Medien von einem Risiko zu einem echten Schutzfaktor für die psychische Gesundheit werden.
Ausblick: Chancen für Aufklärung und Innovation
Gerade Kinder- und Jugendpsychotherapeut:innen stehen in ihrem Alltag vor der Herausforderung, Jugendliche in einer stark digitalisierten Welt zu begleiten. Die Studienergebnisse zeigen: Junge Menschen suchen online nach Orientierung, landen dabei jedoch häufig bei ungeprüften oder irreführenden Inhalten. Gleichzeitig eröffnen sich hier auch neue Chancen für die Fachwelt. Soziale Medien können – verantwortungsvoll genutzt – wertvolle Plattformen sein, um niedrigschwellig über psychische Gesundheit, Therapieangebote und den sinnvollen Einsatz digitaler Tools zu informieren.
Einsatz von KI auf beiden Seiten
Auch moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) spielen dabei eine immer wichtigere Rolle und finden zunehmend Einzug in die psychotherapeutische Praxis. Während Jugendliche, wie in der Aachener Studie gezeigt, bereits Tools wie ChatGPT zur Bewältigung psychischer Belastungen nutzen, zeigt sich auf der Seite der Behandelnden ein anderes, professionelles Anwendungsspektrum: Lösungen wie die von VIA HealthTech integrieren sichere KI-Assistenten in den Praxisalltag, um Therapeut:innen bei Dokumentation und Berichtserstellung zu entlasten. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche – die Arbeit mit den Patient:innen.
Gerade in den sozialen Medien kann Aufklärung dazu beitragen, Ängste gegenüber neuen Technologien abzubauen, Vertrauen zu schaffen und die Chancen digitaler Innovation sichtbar zu machen. Denn nur wenn Fachkräfte, Patient:innen und Gesellschaft die Potenziale digitaler Werkzeuge verstehen und verantwortungsvoll nutzen, kann Digitalisierung in der Psychotherapie ihr volles unterstützendes Potenzial entfalten.